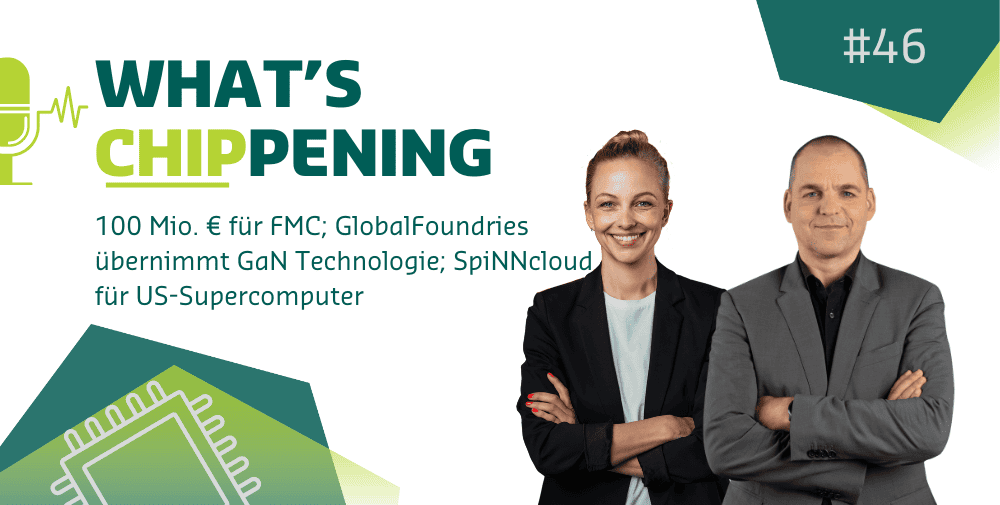Mit einem kräftigen Schub – Verzeihung, Boost, startet die Start-up Landschaft Mitteldeutschlands in die zweite Jahreshälfte:
Das Konzept der boOst Ecosystem gGmbH wurde als eines von zehn deutschen Projekten im Rahmen des EXIST-Flaggschiffwettbewerbs „Startup Factories“ ausgewählt. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte am 10. Juli 2025 in Berlin – ein Meilenstein für das sächsische Startup-Ökosystem und ein klares Signal für die Bedeutung von Deeptech, Halbleitertechnologien und Health Tech in der Region.
Das boOst Startup Ecosystem, koordiniert von der TU Dresden und der Universität Leipzig, erhält damit bis zu zehn Millionen Euro Bundesförderung, die durch mindestens ebenso viel aus der Industrie ergänzt werden. Ziel: Die Zahl wissensbasierter Gründungen in Sachsen und Thüringen bis 2030 zu verdoppeln und die nächste Generation von Hightech-Unternehmen „Made in Germany“ zu etablieren.
Was sind eigentlich „Startup Factories“?
Das Konzept der Startup Factories ist schnell erklärt: Es handelt sich um strukturierte Innovationszentren, die technologieorientierte Gründungen von der Forschung bis zum Markterfolg systematisch begleiten. Als Vorbild gilt unumstritten UnternehmerTUM in München – Europas größtes Gründerzentrum, das eng mit der TU München verbunden ist. UnternehmerTUM bietet nicht nur ein 1.500 Quadratmeter großes MakerSpace, sondern auch ein umfassendes Netzwerk, Mentoring, Zugang zu Kapital und gezielte Programme für Deeptech-Startups. Die Zahlen sprechen für sich: Über 100 schnell wachsende Tech-Startups pro Jahr, mehr als 2 Milliarden Euro eingeworbenes privates Wagniskapital allein 2024 und ein Ökosystem, das von der Financial Times als Europas bestes Start-up-Hub ausgezeichnet wurde.
Ein Blick auf die Finanzierung offenbart jedoch einen kleinen Haken: Während UnternehmerTUM mit satten 40 Millionen Euro Startkapital ausgestattet wurde – Susanne Klatten sei Dank – stehen den neuen Startup Factories jeweils „nur“ 10 Millionen Euro zur Verfügung, und zwar unter der Bedingung, dass private Akteure Mittel in gleicher Höhe einbringen. Für die von eher kleineren Strukturen geprägte Wirtschaftslandschaft im Osten der Republik ist dies eine besondere Herausforderung – noch immer hat kein einziger DAX-Konzern hier seinen Hauptsitz. Insgesamt wird mehr investiert als beim Start von UnternehmerTUM – aber eben an zehn Standorten. Ob das die notwendige Schlagkraft für den internationalen Wettbewerb bringt, bleibt abzuwarten.
Die Lage der Startups: Deutschland, Europa und die Welt im Vergleich
Wie steht es aktuell um die deutschen und europäischen Startups, insbesondere im Deeptech- und Halbleiterbereich? Deutschland belegt im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz, was Investitionen und die Zahl der Gründungen betrifft: 2024 flossen über 9,5 Milliarden Euro in deutsche Startups, vor allem in Cleantech, KI und Fintech. Dennoch bleibt die Skalierung eine Herausforderung – insbesondere im internationalen Vergleich mit den USA und China, die bei KI-Chips und generativer KI deutlich voraus sind. Ein Blick auf die „Unicorn-Dichte“ (also die Zahl der Einhörner pro Million Einwohner) zeigt: Israel (5,6), Estland (3,0) und Singapur (2,4) führen das globale Ranking an. Die USA kommen auf 1,8, während Deutschland und andere europäische Länder deutlich dahinterliegen. Stockholm ist nach dem Silicon Valley die europäische Stadt mit den meisten Unicorns pro Kopf – ein Beleg dafür, dass gezielte Innovationspolitik und Ökosysteme Wirkung zeigen können. In Sachsen selbst ist die Dynamik spürbar: Laut Sachsen Startup Monitor 2025 gibt es 698 aktive Startups, davon 14% im Deeptech-Bereich. Dresden und Leipzig sind die Hotspots, über 65 % der Gründer:innen profitieren von der Nähe zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen – ein Wert, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Allerdings gibt es Nachholbedarf bei der Internationalisierung und beim Zugang zu Kapital: Nur 24 % der Gründenden bewerten die Finanzierungslage als positiv, und der Anteil internationaler Talente ist mit 21 % unterdurchschnittlich.
Venture Capital bleibt Engpass
Die Verfügbarkeit von Venture Capital (VC) in Deutschland hat sich in den letzten Jahren zwar verbessert und der Markt ist deutlich reifer geworden, dennoch besteht weiterhin ein erheblicher Rückstand gegenüber internationalen Hotspots wie den USA oder Israel. Während in den USA pro Jahr rund 150 Milliarden US-Dollar an VC-Kapital investiert werden, liegt Deutschland mit etwa 9,5 Milliarden Euro deutlich zurück. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und zur Zahl der Startups ist das verfügbare VC-Kapital in Deutschland also weiterhin knapp bemessen. Das erschwert insbesondere Deeptech- und Halbleitergründungen, die auf größere Finanzierungsrunden angewiesen sind.
Europäische Zusammenarbeit als Chance
Um diese Schwäche zu überwinden, gewinnt die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zunehmend an Bedeutung. Initiativen wie das Chips Venture Forum von aCCCess (https://www.linkedin.com/company/acccess) bringen Investoren, Startups und Innovationsakteure aus ganz Europa zusammen und schaffen so neue Möglichkeiten für grenzüberschreitende Finanzierungen und Partnerschaften. Das nächste Chips Venture Forum von aCCCess (https://www.blumorpho.com/chips-venture-forum/ ) bietet eine ideale Plattform, um diese Potenziale zu heben und gemeinsam die europäische Startup-Landschaft zu stärken.
Staat als Nachfrager: Raumfahrt, Militär und Hightech-Agenda
Ein entscheidender Hebel für die Entwicklung von Deeptech-Startups ist der Staat selber – als Pilotkunde, Ankerkunde und Motor von Innovationen. Dies ist besonders im Bereich von sicherheitsrelevanten Technologien der Fall – ob KI, Mikroelektronik oder auch Raumfahrt.
Die Hightech-Agenda Deutschland 2025 – bzw. der derzeit vorliegende Referentenentwurf – betont ausdrücklich die Rolle des Staates als Impulsgeber und Innovationsnachfrager, um technologischen Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Dazu gehören insbesondere:
- Public-Private Partnerships, die gezielt staatliche und wirtschaftliche Akteure verbinden, um gemeinschaftlich Innovationen voranzutreiben.
- Technologiewettbewerbe und gezielte Fördermaßnahmen, bei denen der Staat Rahmenbedingungen schafft und Investitionen anregt.
- Die Unterstützung von Startups durch vereinfachte, beschleunigte öffentliche Beschaffungsprozesse mit erhöhten Schwellenwerten für Direktvergaben. Dies soll den Zugang von jungen Technologieunternehmen, gerade in forschungsintensiven Bereichen wie Raumfahrt, Verteidigung, Biotechnologie und Mikroelektronik, erleichtern.
- Die Vernetzung von Forschungsförderung, Industriepolitik und Sicherheitsinteressen, sodass innovative Hightech-Lösungen aus Deutschland schnell Marktreife erlangen und national sowie international wettbewerbsfähig werden.
- Aufbau und Stärkung strategischer Forschungsfelder und Schlüsseltechnologien, etwa KI, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie und Luft- und Raumfahrt.
Die Hightech-Agenda sieht den Staat dabei nicht nur als regulatorische Instanz, sondern aktiv als Nachfrager und Beschaffer, der durch zielgerichtete Aufträge und Pilotprojekte die Markteinführung von innovativen Produkten und Dienstleistungen unterstützt. Dies beinhaltet auch den Ausbau von Test- und Erprobungsinfrastrukturen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich.
Mit dieser engen Verzahnung aus Forschung, Wirtschaft und staatlicher Nachfrage will Deutschland seine Position als Technologiestandort stärken und das Entstehen und Wachstum von Deeptech-Startups fördern. Eine Neuheit – auch die Grenze zwischen militärischer und ziviler Forschung soll dabei weniger streng gehandhabt werden – konkret sollen Synergiepotenziale zwischen ziviler und militärischer Forschung und Entwicklung gehoben werden.
Verglichen mit US-Programmen wie SBIR oder SpaceWERX ist der deutsche Ansatz damit stärker eingebettet in eine umfassende Hightech-Strategie, die über einzelne Förderprogramme hinausgeht und auf eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit setzt. Der Haken hierbei, es wurde bereits erwähnt; Noch reden wir von einem Dokument, welches noch nicht einmal vom Bundeskabinett beschlossen ist. Die nächsten Monate werden zeigen, ob und wie schnell die durchaus sehr zu begrüßenden Pläne umgesetzt werden.
Die EU-Ebene: europäische Startup-Strategie
Mit der neuen europäischen Startup- und Scaleup-Strategie „Choose Europe to Start and Scale“ will auch die EU den Kontinent zum attraktivsten Standort für technologiegetriebene Gründungen machen. Über 35.000 Startups und 3.400 Scaleups beschäftigen bereits 3,5 Millionen Menschen in Europa – doch nur 8 % der globalen Scaleups stammen aus der EU, und der Anteil am weltweiten Wagniskapital liegt bei mageren 5 %. Die Strategie setzt auf fünf Säulen: innovationsfreundliche Regulierung, besseren Zugang zu Kapital, Marktzugang und Expansion, Talentförderung und Zugang zu Infrastruktur. Mit Initiativen wie dem „Lab to Unicorn“-Programm, dem Ausbau des European Innovation Council und der Einführung eines digitalen EU-Betriebsregimes sollen die „Todeszonen“ für Startups – Markteintritt und Skalierung – überwunden werden.
Inwiefern dabei auch Kleinteiligkeit durch (abgestimmte) Einzelstrategien der Mitgliedsstaaten überwunden oder eben auch weiter zelebriert wird – das gilt es abzuwarten. An dieser Stelle soll dazu noch kein finales Urteil erfolgen.
Fazit
Mit der Auswahl von boOst als Startup Factory und der geballten Innovationskraft auch im Silicon Saxony ist ein wichtiger Schritt getan. Doch der internationale Vergleich zeigt: Es braucht mehr als nur Fördergelder – es braucht Mut zur Skalierung, Offenheit für internationale Talente und einen Staat, der als Innovationsmotor agiert – und europäische Zusammenarbeit kann dabei sicher nicht schaden.
Die nächsten Monate und ggf. Jahre werden zeigen, ob die neuen Startup Factories tatsächlich zu europäischen Unicorn-Schmieden werden – oder ob wir weiter „more with less“ machen müssen. Persönlich hoffe ich natürlich auf Ersteres, speziell für BoOst auch mit einer guten Portion #Ostimismus.
Ihr/Eurer Frank Bösenberg
Weiterführende Links
👉 Startup-Monitor Sachsen
👉 TU Dresden: Millionen für mitteldeutsche Startup Factory: „boOst“-Gründungszentrum überzeugt in Leuchtturmwettbewerb des Bundes
👉 EU-Kommission legt Strategie für Start-ups und Scale-ups in der EU vor
👉 Europäische Startup Strategie
👉 Factsheet EU: Open for startups & scaleups
👉 aCCCess Chips Venture Forum im November 2025
👉 Aufzeichnung Informationswebinar aCCCess Chips Venture Forum