Künstliche Intelligenz sorgt für Umbruch in der Branche – und in der Arbeitswelt. Software-Unternehmen, die keine KI einsetzen, werden in zwei bis
fünf Jahren nicht mehr existieren, wagt Frank Schönefeld, Telekom MMS eine Prognose.
Kategorien
Künstliche Intelligenz sorgt für Umbruch in der Branche – und in der Arbeitswelt. Software-Unternehmen, die keine KI einsetzen, werden in zwei bis
fünf Jahren nicht mehr existieren, wagt Frank Schönefeld, Telekom MMS eine Prognose.
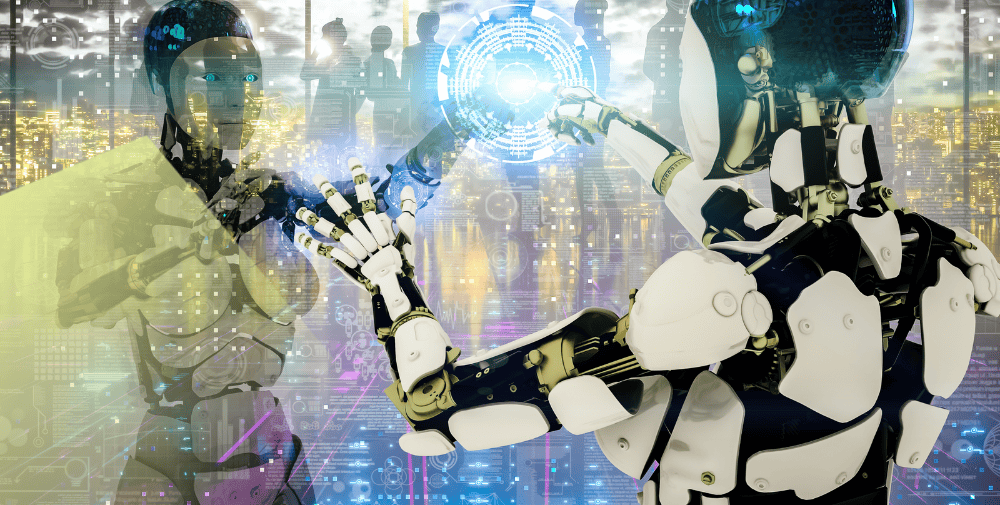
Kategorien
Schlagworte
Schon heute verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Softwarebranche rasant: Sie automatisiert Prozesse, optimiert Arbeitsabläufe und ermöglicht die Entwicklung neuer, innovativer Produkte. Und nach Meinung vieler Experten steht der eigentliche KI-Masseneinsatz erst noch bevor. Doch welche Auswirkungen hat dieser Trend auf die Softwareunternehmen selbst? Welche Jobs werden durch KI obsolet, und wie wird sich der Arbeitsmarkt in der Branche verändern?
Vor allem auf zwei Pfaden ist dieser Wandel längst im Gange, schätzt Innovationsdirektor Christoph Kögler von Infineon Dresden ein: Einerseits setzen Unternehmen KI ein, um Entscheidungsprozesse zu automatisieren und kreative Tätigkeiten, die bisher von Menschen ausgeführt wurden, durch Softwaresysteme zu unterstützen. „Ersteres gibt es schon länger insbesondere in hoch automatisierten Fabriken beispielsweise der Halbleiter-, Automobil- oder Pharmaindustrie“, betont Kögler. „Ein Beispiel für letzteres sind die recht neuen generativen KI wie ChatGPT, welche inzwischen auch recht gut Programmcode erzeugen können. Damit wird die Softwareentwicklung schneller und produktiver.“
Anderseits ermögliche die KI-Technologie neue Produkte: „Im Falle Infineon sind das zum Beispiel Hardware und Software für autonome Fahrfunktionen in Autos oder Lösungen zur vorausschauenden Wartung von Maschinen und Anlagen für unsere Industriekunden. Hier stellt KI ein neues Umsatz- und auch Wachstumspotential dar.“
Gerade die noch junge „generative KI“ habe das Potenzial, „das Wissensmanagement in Unternehmen zu revolutionieren“, prognostiziert der SAP-KI-Experte Henning Heitkötter. „Durch die Verbindung klassischer ML-Verfahren mit den Fähigkeiten von generativer KI bewegen wir uns in diesem Szenario weg von einer sogenannten schwachen KI, im Englischen ,narrow AI’, was letztlich bedeutet, dass ein KI-Modell nicht nur für eines, sondern für unterschiedliche Anwendungsgebiete eingesetzt werden kann. KI wird zukünftig ein natürlicher Teil von Unternehmenssoftware sein, so wie auch Cloud und mobile Technologien die Unternehmenswelt erobert haben.“
Und da wollen die Akteure im Freistaat ganz vorne mitmischen. „Für Sachsen als software-starker Standort ist KI eine große Chance“, meint Geschäftsführer Thomas Horn von der „Wirtschaftsförderung Sachsen“. „Gerade Software-Unternehmen tun sich ohnehin leichter mit dem Einsatz dieser Technologie. Daraus ergeben sich hier neue Wachstumsmöglichkeiten.“
Neben den Chancen stehen indes auch Risiken: Wer als Unternehmen und Freiberufler nicht bald auf den KI-Zug aufspringt, könnte bald vollkommen den Anschluss verlieren. „Ich wage mal die Prognose: Software-Unternehmen, die keine KI einsetzen, werden in zwei bis fünf Jahren nicht mehr existieren“, meint Technikchef Frank Schönefeld von der Telekom MMS in Dresden. „Wir stehen da alle unter Handlungszwang und sollten die Zeit nutzen.“
Diese Chancen und Risiken sind längst in den Fokus besonders agiler Unternehmen gerückt. „Das reine Texten macht bei uns nur die KI“, erzählt beispielsweise Ronny Siegel, der zusammen mit Marcus Franke „Conversion Junkies“ in Dresden leitet. Das Internetunternehmen der Beiden kurbelt für Onlinehändler deren Geschäfte im Internet an – und dafür sind Produktbeschreibungen, Hintergrundtexte und Code-Optimierung gleichermaßen gefragt. Auch fürs Programmieren setzen die Conversion-Junkies auf ChatGPT, Devin, Gemini & Co. „Die KI kann problemlos Scripte schreiben und bei der Plugin-Entwicklung helfen“, sagt Ronny Siegel. „Dadurch beschleunigen wir die Prozesse, werden produktiver und können unsere Leute für die richtig wichtigen Aufgaben einsetzen.“
Erhebliche Umwälzungen erwartet auch „Aleph Alpha“: Die jüngsten KI-Generationen seien imstande, die Wissensarbeit komplett neu zu gestalten, heißt es vom deutschen KI-Vorzeigeunternehmen. Dies erfordere „ein Mensch-Maschine-Leitbild jenseits von Chatbots“.
„KI löst weder ein Armageddon aus, noch ist sie ein Heilsbringer“
Daniel Abbou, Geschäftsführer, KI-Bundesverband
Das sieht man im KI-Bundesverband ganz ähnlich. Mit einem „ganz großen Impact“ in den nächsten drei bis fünf Jahren rechnet Verbands-Geschäftsführer Daniel Abbou: „KI löst weder ein Armageddon aus, noch ist sie ein Heilsbringer. Man sollte sie entmystifizieren und als ein sehr nützliches Werkzeug sehen“, sagt er. „Künstliche Intelligenz wird viele Routineaufgaben übernehmen und damit Berufe verändern: von der Krankenschwester, die ihre Schichtzeiten nicht mehr mit dem Ausfüllen von Excel-Tabellen verschwenden muss, über zahlreiche repetitive Vorgänge in der Buchhaltung, im automatisierten Einkauf bis hin zur Steuerberatung.“ Und das gelte eben noch mehr und noch früher in Software-Unternehmen.
All dies verändert sowohl die Berufsbilder und Unternehmenskultur in der Software-Branche wie auch den ganzen Arbeitsmarkt. Vorstellen mag man sich das wie die Verschiebungen der 1970er und 1980er Jahre, die der massive Einsatz von Robotern in der Industrie und von PCs in Büros ausgelöst hatten. Auch damals gab es die Befürchtung, beides werde eine Massen-Arbeitslosigkeit auslösen. In der Praxis entstanden jedoch neue Berufsbilder, Jobs und Wertschöpfung. „In der Praxis haben Volkswirtschaften mit hoher Roboterdichte eine besonders niedrige Arbeitslosigkeit – weil sie wettbewerbsfähiger sind“, betont Prof. Frank Schönefeld. Ähnliches sei auch von der jüngsten KI-Welle zu erwarten: „KI wird unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern.“ Dass ganze Professionen wegfallen, sei kaum zu erwarten: „Es wird wohl eher so sein, dass Menschen, die mit KI zusammenarbeiten, einen Vorsprung vor Menschen ohne KI haben werden.“
„Ich glaube nicht, dass kurz- und mittelfristig Berufsprofile in der Software-Branche komplett wegfallen werden“, meint auch Christoph Kögler von Infineon. „Auch wenn es inzwischen erste autonome KI-Agenten für die Softwareentwicklung wie das Programm ,Devin’ des US-Startups Cognition Labs gibt, wird nicht sofort alle Software nur noch automatisch geschrieben. Es wird eher so sein, dass Softwareentwickler künftig deutlich schneller, mit weniger Fehlern und damit insgesamt viel produktiver arbeiten als heute. Das Beherrschen verschiedener Programmiersprachen wird nicht mehr so relevant sein, weil die Code-Generierung zunehmend von KI übernommen wird. Wichtiger wird dagegen das Wissen um die Anwendungsdomäne.“
Ähnlich sieht das Henning Heitkötter von SAP: „Die Nutzung von generativer KI und insbesondere von Sprachmodellen wird aus unserer Sicht nicht dazu führen, dass Jobs in großem Umfang vernichtet werden“, meint er. „Vielmehr wird es zu Verschiebungen und einer größeren Nachfrage nach Arbeitskräften in Bereichen wie Datenanalyse, KI-Entwicklung und -Forschung, KI-Training und -Optimierung, KI-Ethik und KI-Projektmanagement kommen.“
„Schon jetzt steigt die Nachfrage nach KI-Experten deutlich“, berichtet auch Daniel Abbou vom KI-Bundesverband. „Das zielt vor allem auf Anwendungs-Experten, aber auch auf KI-Programmierer.“ Besonders gefragt sind derzeit beispielsweise Prompt-Experten: Fachleute mit ganz unterschiedlichen beruflichen Wurzeln auch jenseits der Informatik, die aber die Kunst beherrschen, ChatGPT, Dalle-E, Gemini, Sora, Luminous & Co. tatsächlich die gewünschten Codes, Essays, Bilder oder Videos abzuringen statt wirrer Artefakte.
Wo aber sollen kleine und mittelständische Unternehmen ohne die prall gefüllten Kriegskassen großer Konzerne die Fachleute für den KI-Einsatz herbekommen? Und dies in einem Technologiesektor mit kurzen Innovatonszyklen, der sich im Monatstakt wandelt? „Wissen, das Du dir über externe Leute vom Arbeitsmarkt einkaufst, ist ohnehin in dem Moment schon veraltet, in dem Du sie einstellst“, meint Ronny Siegel von den „Conversion Junkies“. „Deshalb bauen wir uns unsere KI-Experten selber auf: durch ganz viel Weiterbildung. Wir ermuntern alle, ihre KI-Skills ständig weiterzuentwickeln.“ Schon jetzt zeichnet sich dadurch gerade für die Fachkräfte ein Wandel in der Arbeitskultur ab, der wohl zu hybriden Mensch-KI-Kollektiven führen könnte: „Ich denke, schon bald werden die Entwickler zu Supervisoren, von denen jeder vier bis fünf KIs anleitet.“ Siegels Rat: „Jedes Unternehmen sollte sich sofort ganz aktiv mit dieser Herausforderung beschäftigen. Wir haben etwa ein halbes Jahr gebraucht, um unsere Mitarbeiter auf das heutige Niveau beim KI-Einsatz zu bringen – und da zählt jeder Monat.“
_ _ _ _ _
Heiko Weckbrodt
hweckbrodt@gmail.com
_ _ _ _ _
Dieser Beitrag ist exklusiv für die NEXT „Im Fokus: Software” verfasst worden.