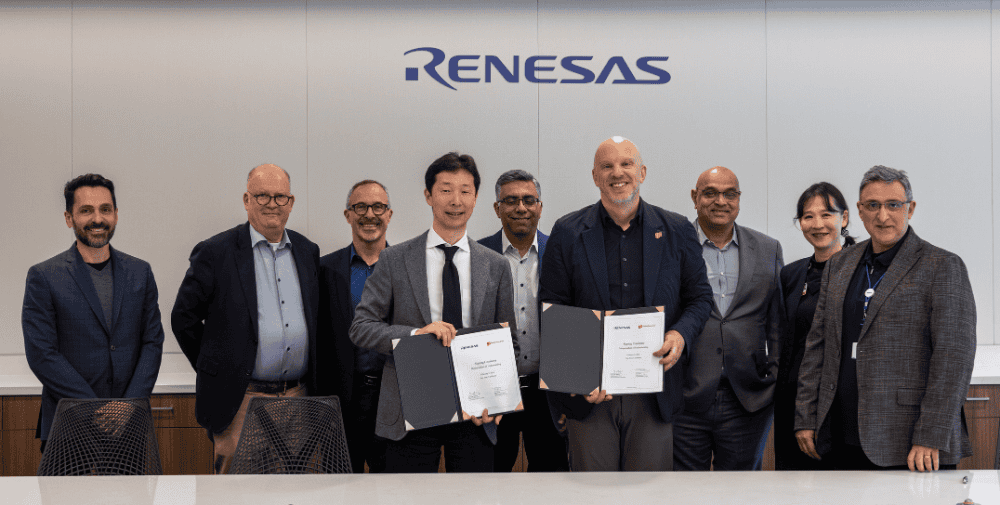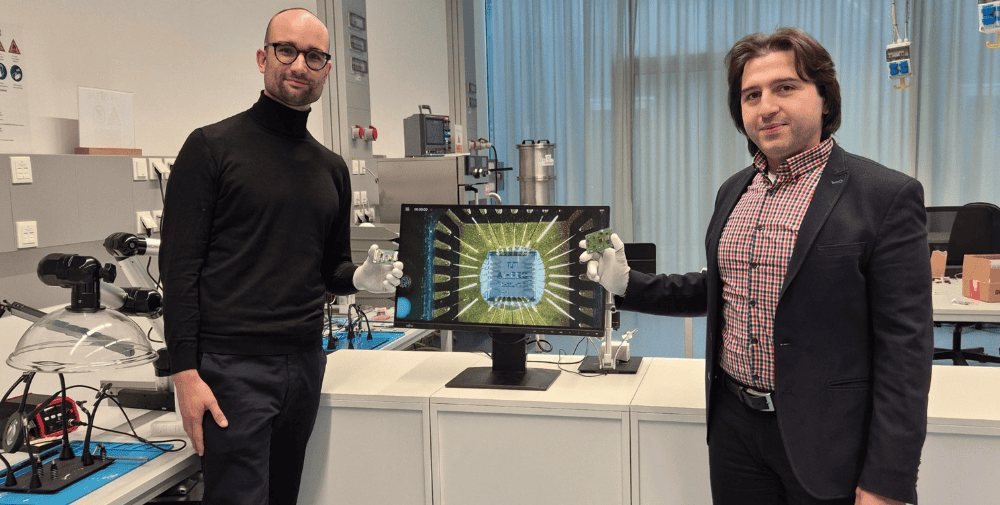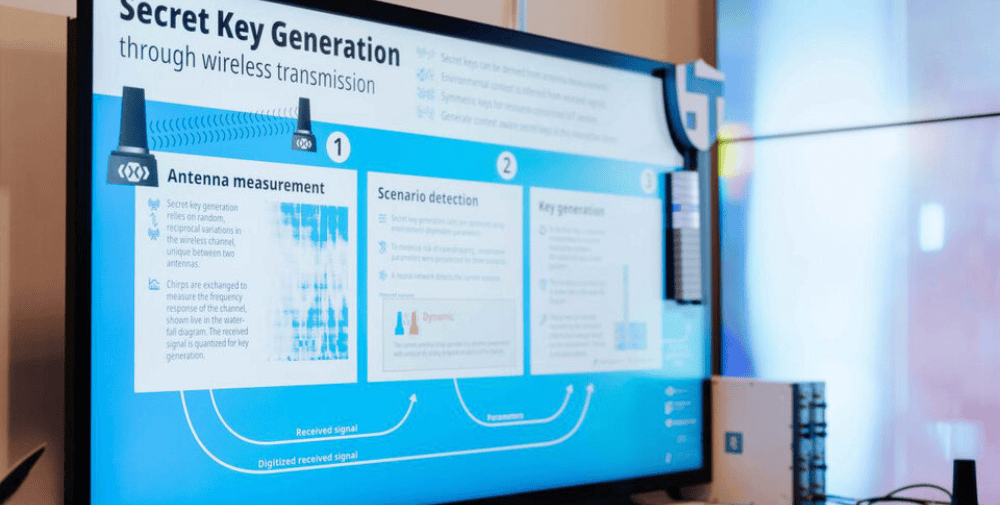Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Mit diesem Mantra lebt es sich weitaus ruhiger. Vielleicht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein wenig zu ruhig. Lange Zeit verließen sich Europa und Deutschland auf ihre internationalen Partnerschaften – speziell auf den transatlantischen Schulterschluss mit den USA. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump hat sich das spürbar verändert. Es brauchte anscheinend den Elefanten im Porzellanladen und einen damit einhergehend Haufen Scherben, um wach zu werden. Verteidigungsbereitschaft, Bildungsinitiativen, Industriepolitik, Fördermechanismen, Zusammenarbeiten und gemeinsame Strategien – eine ganze Reihe seit Jahren geforderter, aber allzu oft verschleppter Notwendigkeiten werden inzwischen nahezu jede Woche angeschoben.
Die Europäische Union geht wichtige Industrie-Projekte an
Allein Ende Februar und Anfang März veröffentlichte die EU eine ganze Reihe längst geforderter Initiativen. So z.B. die „Omnibus-Initiative“, um bestehende Rechtakte zu vereinfachen und damit die überbordende Bürokratisierung einzudämmen. Es wurde zudem der „Clean Industrial Deal“ herausgebracht, um wichtige Klimaziele zu erreichen und Europas Industrie auch in diesem Bereich in die Zukunft zu führen. Ein „Affordable Energy Action Plan“ soll von nun an die Energiepreise für die Industrie senken, Investitionen aktivieren sowie die Resilienz von Wirtschaft und Industrie stärken. Der „Action Plan on the Future of the Automotive Sector“ zielt auf die Stärkung der europäischen Automobilindustrie, einen der wichtigsten und momentan gefährdetsten Industriezweige des Kontinents. Die Initiative „Union of Skills“ verfolgt den Plan, die Förderung von Kompetenzen und damit den europäischen Fachkräftebedarf zu befriedigen. Viel Gutes und Wichtiges also.
Europa und Deutschland kämpfen mit schrumpfender Produktion und Industrie
Warum erst jetzt, fragen sich die einen. Endlich kommen wir ins Machen, jubeln die anderen. Denn dass sich die Welt immer schneller und verrückter dreht, sollte allen Europäer:innen und zuletzt auch allen Sachsen längst aufgefallen sein. Erst in den vergangenen Wochen zeigten erste „Einschläge“ im hiesigen Freistaat, vor welchen Herausforderungen wir in den kommenden Jahren stehen. Mit der Gläsernen Manufaktur in Dresden beendet 2025 ein kleiner, aber umso prestigeträchtiger Produktionsstandort von VW seine Arbeit. Zwar sind es nur wenige Dutzend Fahrzeuge pro Tag, die hier endmontiert wurden, doch zusammen mit dem Blick auf die weiteren Automotive-Produktionsstandorte in Sachsen entsteht ein Bild, das niemandem gefallen sollte. Ganze Produktionslinien und wohl auch Werke (wie z.B. das VW-Werk in Zwickau) werden in den kommenden Jahren verschwinden, wenn keine Wunder passieren. Egal ob bei VW, BMW, Audi oder Mercedes, überall wird gespart, reduziert, verlagert oder sogar eingestellt. Und das ist nur der Blick auf einen Industriezweig, der schwächelt. Deutschland verliert wichtige Teile seiner produzierenden Industrie und damit Branchen, die vor- und nachgelagert eine unglaubliche Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besitzen. Und es verliert wohl auch Kommunikationsbrücken zu einstigen Verbündeten, wie u.a. die drohende Schließung des Leipziger US-Konsulats in diesen Tagen zeigt.
Europa darf sich nicht zwischen USA und China stellen
Sachsen ist damit im Kleinen ein Abbild dessen, was im Großen ganz Deutschland und Europa droht. Wenn der Kontinent nicht schnellstmöglich aufwacht und sich auf alte Stärken und Möglichkeiten besinnt, gehen vielerorts die Lichter aus und werden wohl nie wieder angeschaltet. „Emanzipation“, lautet daher der Ruf der Stunde. Europa muss sich auf sich selbst konzentrieren. Muss das produzieren, was hier benötigt wird. Sollte sich mit jenen verbünden, die derzeit ähnliche Herausforderungen zu meisten haben – wie z.B. Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Großbritannien u.v.m. Ein Bündnis der Willigen muss her und Pläne, wie unabhängige Gegengewichte zu immer stärker dominierenden Staaten wie den USA und China entstehen können. Sich hier auf bloßes Wohlwollen, alte Verbundenheit, wirtschaftliche Abhängigkeiten und pures Glück zu verlassen, wäre mehr als naiv.
Innovationen und Förderung als Motor für Europa
Und tatsächlich scheinen Europa und Deutschland verstanden zu haben. Ob gerade noch rechtzeitig, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Allein der Blick auf die Silicon Saxony Branchen deutet an, welch enormes Entwicklungspotenzial in Europa noch zur Verfügung steht. Es gilt, weiterhin Start-ups und aufstrebende KMU zu fördern. Mehr Geld für den hierfür mitverantwortlichen Europäischen Innovationsrat (EIC) wäre daher wünschenswert. Exzellente Forschung, der Wissenstransfer in die Industrie und damit die Produktion müssen wieder stärker in den Fokus rücken. Wichtige Projekte, wie die Chips Joint Undertaking Pilot Lines im Mikroelektroniksektor, gehören ausgebaut, ebenso Initiativen wie der EU Chips Act.
Ganz Europa von derartigen Initiativen profitieren zu lassen, anstatt sich nur regional und damit punktuell zu verstärken – wie es aktuell bei Projekten des EU Chips Acts zu sehen ist, darunter die Infineon-Erweiterung und die ESMC-Neuansiedlung in Dresden –, ist das Mindset, das wir benötigen. Der EU Chips Act blieb in seiner ersten Version – abseits der Forschung – hinter den geweckten Erwartungen zurück. Es soll jedoch zeitnah einen EU Chips Act 2.0 geben. Wie dieser aussehen könnte und wie er seine Wirkung dieses Mal für ganz Europa entfaltet, wird aktuell beraten. Auch eine gesamteuropäische Mikroelektronik-Strategie steht erstmals zur Diskussion. SEMI und die European Semiconductor Industry Association (ESIA) stehen hier der EU beratend zur Seite. Es bleibt abzuwarten, was diesem Prozess entspringt.
Koalitionen und Allianzen arbeiten aktuell noch nicht auf Top-Niveau
Auch neue Initiativen, wie die Mitte März gestartete Semicon Coalition, einem Bündnis von aktuell neun europäischen Ländern (Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien und den Niederlanden) müssen größer gedacht und besser koordiniert werden. Mit Tschechien, Schweden, Großbritannien und Portugal fehlen hier allein in Europa wichtige Nationen des Mikroelektronikbereiches, die alle eigene Strategie- oder zumindest Positionspapiere für den Bereich vorliegen haben. Dass es aber auch auf internationalem Parkett noch zahlreiche Staaten gäbe, die sich hier hervorragend einbinden ließen, steht außer Frage. Zudem sollten sich unterschiedliche Initiativen nicht kannibalisieren, sondern auf stärkere Zusammenarbeit setzen. Die European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), ein Zusammenschluss wichtiger europäischer Mikroelektronik-Regionen auf politischer Ebene wäre im Bündnis mit der neuen Semicon Coalition eine schlagkräftige Kombination – wenn man es denn möchte und sich entsprechend dafür einsetzt.
Deutschland definiert erstmals eigene Ansprüche und investiert im großen Stil
Nicht zuletzt ist aber auch Deutschland in den nächsten Jahren noch stärker als bisher gefragt. Es kommt viel darauf an, wie sich die neue Bundesregierung zusammenfindet und die deutschen Möglichkeiten, z.B. des 500 Mrd. Euro teuren Sondervermögens, das in den vergangenen Tagen beschlossen wurde, zu nutzen weiß. Von Digitalpakt 2.0 bis zur ausgebauten Förderung von Schlüsselindustrien wie der Mikroelektronik gibt es hier zahlreiche Vorschläge auch für unsere Branchen, jedoch bislang wenig Konkretes. Eine sehr unauffällige – um es diplomatisch auszudrücken – Veröffentlichung eines Mikroelektronik-Positionspapiers für Deutschland ließ zuletzt aufhorchen. Vier Seiten geduldiges Papier legen Schwerpunkte wie Forschung, Fachkräfte und Fertigung sehr allgemein fest. Konkrete Timings, Erfolgsindikatoren, Monitoring oder Verantwortlichkeiten sucht man vorerst vergebens. Doch um es positiv zu betrachten: Es ist ein erster Aufschlag und ein Weg in die richtige Richtung. Auch die Sondierungsgespräche in Richtung der neuen Bundesregierung bieten Potenzial. Vom Wunsch, strategische Industrien, wie die Halbleiterbranche, zu stärken bis hin zum Ausschöpfen des Chips Act und Important Projects of Common European Interest (IPCEI) hat man sich gemeinsam viel vorgenommen.
Es herrscht Aufbrauchstimmung in Europa und Deutschland, doch wohin wird es gehen?
Viele kleine und große Schritte führen Europa, aber auch Deutschland langsam zu all dem, was bisher nur wohlklingende Worte zu sein schienen. Das Bewusstsein, sich auf starke und bislang unverzichtbare Partner nicht mehr verlassen zu können, führt zunehmend zu einer Emanzipation Europas, die viele sich seit langer Zeit wünschen. Statt auf andere zu schauen, schaut man inzwischen auf sich und darauf, was sich aus eigener Kraft bewegen und verbessern lässt. Es sind erste Sonnenstrahlen, die passend zum aktuellen Frühling Aufbruchsstimmung verbreiten. Um den Tag jedoch nicht vor dem Abend loben zu wollen, sollte man sich bewusst sein, dass all das in diesem Artikel Aufgeführte nicht mehr als Absichtserklärungen und zaghafte Anfänge in wichtigen Themenfeldern zu sein scheinen.
Ob und wie Europa sowie Deutschland daraus eine Dynamik entwickeln können, die tatsächlich zu mehr technologischer Souveränität und damit Unabhängigkeit bzw. zurückkehrender eigener Stärke führen, gilt es kritisch und fortlaufend zu betrachten. Die Industrie und auch Verbände wie Silicon Saxony stehen für den Austausch bereit. Nur gemeinsam wird man all das umsetzen können, was sich die EU und Deutschland vorerst nur erträumen bzw. schriftlich postulieren. Verstanden wurde schlussendlich das Wichtigste: Technologische Souveränität wird nie von anderen geliefert. Und bereits diese Erkenntnis ist Gold wert.
_ _ _ _
Silicon Saxony Newsletter & Podcast
Unser Silicon Saxony Newsletter erreicht Sie zweimal im Monat. Ob Aktuelles aus der sächsischen, deutschen oder internationalen Mikroelektronik-, IKT- und Software-Branche, Veranstaltungen aus und für die Tech-Szene bzw. lohnenswerte Aktivitäten, Förderangebote sowie Projekte für Sie und Ihr Unternehmen – wir halten Sie auf dem Laufenden. 👉Newsletter Anmeldung
Bei unserem Podcast „What’s chippening“ ist stets Mikroelektronik-Experte Frank Bösenberg zu Gast. Im Fokus des ca. 15-minütigen Formats stehen aktuelle nationale und internationale Halbleiter-News, die er erklärt, bewertet und einordnet, damit Sie immer bestens informiert in die kommende Woche starten können. 👉Podcast